Aktuelle Rezensionen
kulturbuchtipps.de veröffentlicht regelmäßig Rezensionen zu neuen Büchern aus den Kultur- und Geisteswissenschaften.
Bereits 1802 hatte August Wilhelm Schlegel eine sehr dezidierte Meinung, was Neuerscheinungen betrifft… – Wir betrachten es daher als eine wichtige kulturelle Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen und Ihnen hier die wichtigsten und lesenswerten Sachbücher aus der geradezu unüberschaubaren Menge an Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt vorstellen.
Hier sehen Sie eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Rezensionen bei kulturbuchtipps.de:
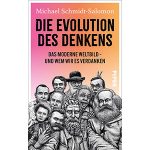 Michael Schmidt-Salomon: „Die Evolution des Denkens. Das moderne Weltbild — und wem wir es verdanken“
Michael Schmidt-Salomon: „Die Evolution des Denkens. Das moderne Weltbild — und wem wir es verdanken“
„Ein Kopf denkt nie allein“. Oder noch platter formuliert: „Von nichts kommt nichts.“ Selbst die klügsten Denker erarbeiten sich ihre Erkenntnisse nicht im luftleeren Raum, sondern greifen auf die Erkenntnisse früherer Denker zurück. Das kreative Gedankenspiel mit den Ideen der Vorgänger, ihre Kombination oder individuelle Interpretation, ihre Kritik oder gar ihre Verwerfung umschreibt jenen schöpferischen Prozess, durch den Neues geschaffen und unser Weltbild immer wieder neu geformt wird.
Isaac Newton hat diese Tatsache des kreativen Umgangs mit den Erkenntnissen früherer Forscher und Denker sehr treffend beschrieben: „Wenn ich weiter gesehen habe [als andere], so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.“ Ohne jene Riesen, die vor ihm bereits an denselben Problemen der Physik arbeiteten, wäre Newton kaum zu seinen revolutionären Erkenntnissen gekommen.
„Die Evolution des Denkens“ von Michael Schmidt-Salomon ist eine tiefgreifende Analyse, die sich mit der Entwicklung des menschlichen Denkens im Laufe der Geschichte befasst.
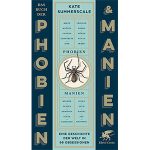 Kate Summerscale: „Das Buch der Phobien und Manien — Eine Geschichte der Welt in 99 Obsessionen“
Kate Summerscale: „Das Buch der Phobien und Manien — Eine Geschichte der Welt in 99 Obsessionen“
Der Begriff der Phobie (abgeleitet von Phobos, dem griechischen Gott der Furcht) wurde ursprünglich vor allem für die Symptome einer körperlichen Krankheit verwendet, bis Benjamin Rush, einer der Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika, ihn erstmals auf psychische Erkrankungen anwendete.
Die erfolgreiche Sachbuchautorin und Journalistin Kate Summerscale führt in ihr neues Buch über die bunte und skurrile Welt der Phobien und Manien ein, indem sie Benjamin Rush als ersten nennt, der bereits im Jahre 1786 ein „modernes“ Verständnis von Phobien gebrauchte, indem er deren Symptome nicht auf körperliche Erkrankungen, sondern auf psychische Probleme zurückführte. Hierbei schlug Rush, so die Autorin, „durchaus einen heiteren Ton an“, wenn er beispielsweise die „Heim-Phobie“ als eine Erkrankung beschrieb, die „bevorzugt Herren befalle, die den Zwang verspürten, nach der Arbeit in der Taverne Halt zu machen“ …
Nun ja. — Dass der heitere Benjamin Rush jedoch auch eine dunkle Seite hatte, verschweigt die Autorin. Denn Benjamin Rush war ein Befürworter einer gewaltanwendenden Psychotherapie.
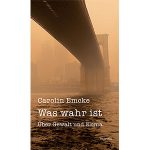 Carolin Emcke: „Was wahr ist — Über Gewalt und Klima“
Carolin Emcke: „Was wahr ist — Über Gewalt und Klima“
Faktuales Erzählen ist ein Erzählen, das sich an der Wirklichkeit orientiert. Im Gegensatz zum fiktionalen Erzählen, das dem Schriftsteller erlaubt, frei zu assoziieren und Geschichten zu erzählen, die (zumindest in Teilen) ausgedacht sind und eine Welt beschreiben, die so nicht in der Wirklichkeit existiert, kommt es beim faktualen Schreiben darauf an, Ausschnitte aus der Wirklichkeit aufzuschreiben, deren Wahrheitsgehalt nachprüfbar ist.
Faktuales Schreiben unterliegt demnach bestimmten Zwängen; es ist ein Erzählen von Ereignissen, die in der Vergangenheit geschehen sind und die durch die Arbeit des Schriftstellers in einen Zusammenhang gebracht und deren Faktizität durch glaubwürdige Belege bestätigt werden.
Im Rahmen ihrer Poetikdozentur für faktuales Erzählen an der Bergischen Universität Wuppertal befasste sich die Schriftstellerin, Journalistin und Publizistin Carolin Emcke 2023 mit den Bedingungen des faktualen Erzählens im Angesicht von Gewalt und Verfolgung, aber auch im Zusammenhang mit der Klimakrise.
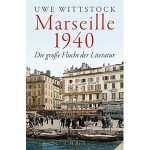 Uwe Wittstock: „Marseille 1940 — Die große Flucht der Literatur“
Uwe Wittstock: „Marseille 1940 — Die große Flucht der Literatur“
Die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte haben einem Mann viel zu verdanken, von dem die allermeisten noch nie gehört haben dürften: dem Amerikaner Varian Fry. Der junge Journalist ist die Zentralfigur in Uwe Wittstocks neuem Buch über die großen Flüchtlingsströme, die sich ab dem Frühjahr des Jahres 1940 über den südfranzösischen Knotenpunkt Marseille auf der Flucht vor der vorrückenden deutschen Wehrmacht in Sicherheit bringen wollen.
Bereits vor einigen Jahren hatte Uwe Wittstock mit „Februar 1933 — Der Winter der deutschen Literatur“ ein packendes Sachbuch geschrieben, das kollagenhaft Tagebucheinträge und Selbstaussagen mit aus zahlreichen Quellen gespeisten Hintergrundinformationen zu einem Bilderbogen der historischen Ereignisse kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zusammenstellt.
Was sich liest wie ein temporeicher Roman, ist jedoch leider keine Fiktion, sondern war der reale Albtraum einer ganzen Schriftsteller- und Intellektuellen-Generation in Deutschland nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.
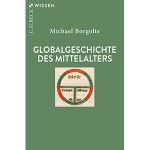 Michael Borgolte: „Globalgeschichte des Mittelalters“
Michael Borgolte: „Globalgeschichte des Mittelalters“
Nur auf den ersten Blick scheint die Globalisierung ein modernes Phänomen zu sein, welches die Gegenwart von der Vergangenheit unterscheidet. Jedoch bei genauerer Betrachtung wird klar, dass es transnationale und transkontinentale Verflechtungen auch schon viel früher gab, nicht erst seit der Frühen Neuzeit und der im 15. Jahrhundert einsetzenden Kolonialisierung der Welt im Zuge des europäischen Imperialismus, sondern noch früher, sowohl im Mittelalter als auch, genau genommen, schon in der Antike.
Legt man nämlich als Maßstab für eine Globalisierung die jeweils bekannte Welt eines Zeitalters zugrunde, so lässt sich durchaus auch für das antike Griechenland oder das Römische Reich — basierend auf den Handelswegen und dem Austausch zwischen den Kulturen — von Prozessen einer Globalisierung sprechen.
Der Drang des Menschen, über die eigenen Grenzen hinaus ins Unbekannte vorzustoßen, hat nicht nur die Entdecker beflügelt, sondern auch den Handel. Obwohl man natürlich in jenen Epochen der Weltgeschichte noch nicht von Nationalstaaten im modernen Sinne sprechen kann und es somit auch keinen Sinn machen würde, von transnationalen Verflechtungen zu sprechen, so lassen sich dennoch Prozesse des kulturellen Austauschs und des Aufbaus stabiler Handelsbeziehungen nachweisen.
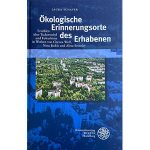 Laura Schaper: „Ökologische Erinnerungsorte des Erhabenen“
Laura Schaper: „Ökologische Erinnerungsorte des Erhabenen“
Die Autorin beschäftigt die Frage, ob und wie man die gewaltigen Kräfte der Natur und die menschliches Verstehen und Vermögen übersteigenden Auswirkungen menschengemachter Naturkatastrophen literarisch abbilden lassen und wie von ihnen erzählt werden kann undd muss.
Exemplarisch untersucht sie an Werken von Christa Wolf, Nina Jäckle und Alina Bronsky und den atomaren Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima die Möglichkeiten erzählerischer Verarbeitung jener Konfrontation mit dem „Erhabenen“.
In der Ästhetik wird von Erhabenheit gesprochen, wenn wir in Berührung mit etwas kommen, was die normale Wahrnehmung bei weitem übersteigt: Die Erhabenheit der Schönheit der Natur ist hierfür ein gutes Beispiel. Doch erhaben sind nicht nur jene faszinierenden und schönen Ansichten in der Kunst und der Natur, sondern auch jene Erscheinungen, die uns unsere eigene Machtlosigkeit und unsere Ohnmacht deutlich machen: ein Vulkanausbruch, ein starkes Gewitter oder auch die gewaltige Explosion eines Kernreaktors.
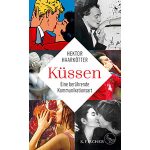 Hektor Haarkötter: „Küssen — Eine berührende Kommunikationsart“
Hektor Haarkötter: „Küssen — Eine berührende Kommunikationsart“
Ersetzen Sie einfach in Gedanken jedes „Du und ich“ in diesem Buch durch das viel leichtere und nicht so aufdringliche „Wir“, und schon werden Sie dieses Buch (und seinen Autor!) lieben und — ja, warum nicht?! — auch gerne küssen wollen, wie es der Autor gleich zu Beginn im Rahmen eines kleinen Alltagsexperiments empfiehlt.
Denn was der Professor für Kommunikationswissenschaft über diese „berührende Kommunikationsart“ zusammengetragen und zu sagen hat, ist wirklich interessant, teilweise kurios und immer unterhaltsam.
Ersetzt man also jedes „Du und ich“ durch „wir“, so landet man stilistisch bei Klassikern der Kunst- und Kulturgeschichten, bei Egon Friedell und bei Eduard Fuchs. Weder Fuchs noch Friedell waren Teil des akademischen Wissenschaftsbetriebs ihrer Zeit, sondern waren — wie man heute herablassend sagen würde — nur „interessierte Laien“ ohne Hochschul-Abschluss, die Bücher über Themen verfassten, die sie interessierten. Aber vielleicht war es ja gerade diese Leerstelle akademischer Qualifikation, welche ihnen geholfen hat, über all das, was sie für bemerkenswert hielten, mit Begeisterung und Leidenschaft zu schreiben und dabei mühelos die austrocknende Wirkung wissenschaftlichen Arbeitens auf den Text zu vermeiden?
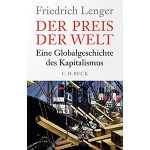 Friedrich Lenger: „Der Preis der Welt — Eine Globalgeschichte des Kapitalismus“
Friedrich Lenger: „Der Preis der Welt — Eine Globalgeschichte des Kapitalismus“
Der Kapitalismus hat sich weltweit als das führende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem durchgesetzt. Diese Entwicklung vollzog sich nicht immer gleichförmig und erfolgreich, sondern war über die Jahrhunderte auch von gegenläufigen Entwicklungen und Rückschlägen geprägt. Diese Entwicklungsgeschichte nimmt der renommierte Historiker Friedrich Lenger in seinem neuen Buch in den Blick, wobei er sich nicht auf eine (vielleicht für manchen immer noch naheliegend erscheinende) eurozentrische Perspektive beschränkt, sondern vielmehr eine Globalgeschichte des Kapitalismus nachzuzeichnen versucht.
Friedrich Lenger ist Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Gießen — und genau einen solch weiten historischen Blick über Mittelalter und Neuzeit bis in die Gegenwart braucht es, um eine Globalgeschichte des Kapitalismus zu erzählen, die nicht wie gewöhnlich nur die letzten 500 Jahre seit der Renaissance umfasst. Wenn auch vor 500 Jahren eine neue Entwicklung von den italienischen Handelsstaaten ausging, so liegen ihre Wurzeln in der Zeit davor und führen uns weiter zurück in die Vergangenheit.
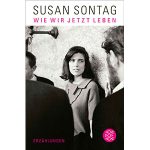 Susan Sontag: „Wie wir jetzt leben — Erzählungen“
Susan Sontag: „Wie wir jetzt leben — Erzählungen“
Mit dem Namen Susan Sontag verbinden wir vor allem gesellschafts- und kulturkritische Essays, wie „Anmerkungen zu Camp“, ihrem vielleicht bekanntesten Essay (1964), oder auch ihre kritischen Auseinandersetzungen mit den modernen Medien und vor allem der Fotografie; wir kennen die 1933 geborene und 2004 gestorbene Amerikanerin als streitlustige und meinungsstarke Kulturkritikerin trat Susan Sontag. —
Aber Susan Sontag als Schriftstellerin und Verfasserin von Short Stories? Das wird für viele Leserinnen neu sein, dabei hat sie neben den Essays und anderen Texten, die sich kritisch mit Kultur und Gesellschaft auseinandersetzten, auch einige Romane und autobiographische Schriften veröffentlicht.
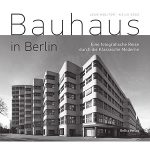 Jean Molitor und Kaija Voss: „Bauhaus in Berlin — Eine fotografische Reise durch die Klassische Moderne“
Jean Molitor und Kaija Voss: „Bauhaus in Berlin — Eine fotografische Reise durch die Klassische Moderne“
Es geschieht leider nicht allzu häufig, dass ein derart perfekt durchgestaltetes und in seiner Art von A bis Z stimmiges Buch auf dem Tisch des Rezensenten landet. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass mit dem vorliegenden neuen Band „Bauhaus in Berlin — Eine fotografische Reise durch die Klassische Moderne“ dem großartigen architekturgeschichtlichen Werk zum Bauhaus in der Weimarer Republik des Autorenteams Molitor und Voss ein weiterer wichtiger Baustein hinzugefügt wird.
Wie schon in den zuvor erschienenen Bildbänden („Bauhaus — Eine fotografische Weltreise“ und „Bauhaus in Bayern“) verschmelzen auch in dieser Neuerscheinung Bild und Text zu einer geradezu kongenialen Einheit; perfekt ergänzen die Texte der Architekturhistorikerin Kaija Voss die wunderschön zeitlosen Schwarzweiß-Fotografien des Fotografen Jean Molitor.
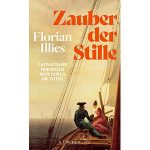 Florian Illies: „Zauber der Stille — Caspar David Friedrichs Reisen durch die Zeiten“
Florian Illies: „Zauber der Stille — Caspar David Friedrichs Reisen durch die Zeiten“
Die träumerischen und oftmals melancholischen Gemälde von Caspar David Friedrich sind heutzutage für uns der Ikonen der deutschen Romantik. Ob „Der Wanderer über dem Nebelmeer“, die „Kreidefelsen auf Rügen“, „Der Mönch am Meer“ oder die „Abtei im Eichwald“ — Keiner hat diese von einer tiefen Sehnsucht geprägte und scheinbar so urdeutsche Gefühlswelt der Romantik besser illustriert als er. Jedoch die Tatsache, dass wir Caspar David Friedrich so instinktiv und untrennbar mit der deutschen Romantik verbinden, ist keineswegs selbstverständlich; nach seinem Tod war der Maler lange, lange Zeit fast vergessen, erst spät in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen Maler des Realismus und Symbolismus seine teilweise radikalen Bildkonzepte zu schätzen; seine Wiederentdeckung durch das Publikum ließ noch länger auf sich warten.
Der Kunsthistoriker, Journalist und Autor Florian Illies hat sich intensiv mit dem Leben und Werk von Caspar David Friedrich befasst. Wie man es von ihm gewohnt ist, beinhaltet diese intensive Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand gleichermaßen dessen extensive Bearbeitung. Illies beschenkt seine Leser mit den Früchten einer komplexen und umfassenden Recherche, die sowohl in die Breite der vielfältigen Verknüpfungen von Werk und Leben des Künstlers ausgreift als auch die Tiefen des jeweiligen Gegenstands auslotet.
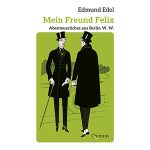 Edmund Edel: „Mein Freund Felix — Abenteuerliches aus Berlin W. W.“
Edmund Edel: „Mein Freund Felix — Abenteuerliches aus Berlin W. W.“
„Berlin W. W.“, das ist der Neue Westen der Reichshauptstadt, die Gegend rund um den Kurfürstendamm. Wir schreiben das Jahr 1914. Die Welt der Wohlhabenden und Besserverdiener lässt es sich gutgehen. Man trifft sich, lässt sich sehen, sucht „Gesellschaft“ und lädt auch selbst zu „Gesellschaften“. Nicht selten finden diese in den Privaträumen der großzügigen und vielräumigen Wohnungen der noch frisch im Glanze stehenden Bürgerhäuser aus der Gründerzeit statt. Selbstverständlich dienen solche Veranstaltungen der Repräsentation — und selbstverständlich werden die privaten Räumlichkeiten hierzu nicht in ihrem Originalzustand belassen, sondern zum Zwecke der Repräsentation ordentlich rausgeputzt.
„Mundus vult decipi“, weiß der Bildungsbürger — die Welt will betrogen sein —, und so nimmt man dankend den Service von sogenannten „Tafelverleihinstituten“ in Anspruch, die neben Tafelgeschirr, Sitzmöbeln und Tischdekorationen auch gleich noch einige ansprechende Kunstobjekte für den Abend mit verleihen, welche die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich ziehen und ihren Glanz auf die Gastgeber zurückstrahlen sollen.
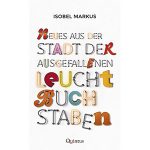 Isobel Markus: „Neues aus der Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben“
Isobel Markus: „Neues aus der Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben“
Der Buchtitel klang witzig, und die Empfehlung vonseiten des Quintus-Verlags zur Lektüre dieser Neuerscheinung war freundlich und nachdrücklich: Isobel Markus. So so. Na, werfen wir mal einen Blick in das Büchlein …
Im Nachhinein ist es schon etwas peinlich — um nicht zu sagen: unverzeihlich —, dass man als kulturinteressierter und in Mitte-Tiergarten lebender Urberliner weder von Isobel Markus, noch von ihrer Kolumne oder von ihrem Salon gehört hat, obwohl man nur wenige S-Bahn-Stationen vom Weltgeschehen entfernt wohnt! (Liebe Frau Markus, es tut mir aufrichtig leid, und es wird ganz sicher nicht mehr vorkommen, denn nun kenne ich ja ihr zweites Leuchtbuchstaben-Büchlein — und es war eine wunderbare Lektüre!)
Selten wird einem Rezensenten heutzutage die Freude zuteil, etwas Überraschendes, Erfrischendes, Neuartiges auf seinem Schreibtisch zu finden. Die große Mehrheit der Neuerscheinungen ist ordentlich gemacht, wenigstens leidlich lektoriert und von den gröbsten orthographischen Fehlern befreit, gut geschrieben und sauber recherchiert.
 Andreas Altmann: „Morning has broken — Leben Reisen Schreiben“
Andreas Altmann: „Morning has broken — Leben Reisen Schreiben“
Ein neues Buch von Andreas Altmann bedeutet: einen Weltbürger auf seinen Reisen zu begleiten und seine Begegnungen mit Menschen und fremden Kulturen — mittelbar — mitzuerleben. Das Mittel, das Medium, ist in diesem Fall die Sprache und das geschriebene Wort. Altmanns Sprache ist schnörkellos und direkt, manchmal auch sehr direkt, was in unseren Zeiten mit ihrer oftmals verkrampften sprachpolizeilichen Verbissenheit bei der Verfolgung des hehren Ziels einer gendergerechten und niemanden verletzenden Sprache durchaus erfrischend sein kann.
Wie in all seinen Büchern, so spielen auch die Geschichten dieses neuen Buches wieder sehr nahe am Leben; wollte man eine Modefloskel unserer Zeit bemühen, so ließe sich geradezu von „immersiver Literatur“ sprechen, weil sie den Leser durch ihre realistischen und detailreichen Beschreibungen förmlich in die Geschichten hineinzieht. Aber handelt es sich hier überhaupt um Literatur? Altmann erfindet ja nichts, sondern er beschreibt seine Erlebnisse und liefert so lebensnahe Reportagen aus den eher unwirtlichen Ecken der Welt, aus Ländern und Gegenden, die eher weniger von Touristen bereist werden.
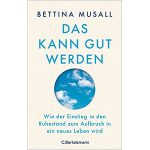 Bettina Musall: „Das kann gut werden – Wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird“
Bettina Musall: „Das kann gut werden – Wie der Einstieg in den Ruhestand zum Aufbruch in ein neues Leben wird“
Es ist stets sinnvoll, sich einen komplexen Prozess anschaulicher zu machen, indem man sich ein Bild macht. Der scheinbare Umweg der Verbildlichung verkürzt den Erkenntnisprozess; die Suche nach Vergleichen und das Finden einer passenden Allegorie fördern das Verständnis.
Wenn es um den Weg aus der Berufstätigkeit und den Weg in den Ruhestand geht, so bieten sich gleich mehrere Vergleiche an: das Leben als Wanderung, als langsamer Fluss, als Kanufahrt durch Stromschnellen oder auch als Segeltörn auf einem stillen See. Wir können das Leben beschreiben als zirkulären Prozess — als einen potenziell endlosen Kreislauf — oder auch als lineare Bewegung — als eine mehr oder weniger gerade verlaufende Strecke von A nach B.
Vergleichen wir beispielsweise unseren beruflichen Werdegang mit einer Wanderung, präziser: mit einer Bergwanderung, so beschreibt dieses Bild den mitunter mühsamen Weg zum Gipfel. Ist der Gipfel erreicht, so endet das Berufsleben zwar im Triumph der erreichten Leistung; die Kehrseite dieses an sich schönen Bildes besteht allerdings darin, dass es nach dem Erklimmen des Gipfels eigentlich immer nur bergab gehen kann … Kein besonders geeignetes Bild — es sei denn, Sie sind Pessimist.
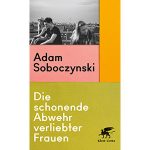 Adam Soboczynski: „Die schonende Abwehr verliebter Frauen“
Adam Soboczynski: „Die schonende Abwehr verliebter Frauen“
Die Kunst der Verstellung — diesem Thema widmet Adam Soboczynski diesen kleinen Lebensratgeber. Anhand von dreiunddreißig „Fallbeispielen“ führt der Autor den Leser in verschiedene Nuancen jener hohen Kunst der Verstellung ein, die uns in den Augen der Anderen zu angenehmen, liebenswerten, attraktiven und erfolgreichen Menschen machen kann.
Der natürliche erste Reflex mag für gewöhnlich darin bestehen zu bestreiten, dass man sich im normalen Leben verstelle bzw. verstellen müsste; der zweite Reflex darin, die Verstellung als Grundlage des eigenen Erfolgs abzustreiten. Schließlich wollen wir alle möglichst authentisch sein; Authentizität ist der neue Fetisch unserer Zeit.
Doch seien wir ehrlich mit uns und den Anderen: Würden wir uns nicht im sozialen Miteinander auf die eine oder andere Art verstellen, so wäre der Alltag für jeden von uns unglaublich anstrengend, äußerst ernüchternd und mitunter sogar lebensbedrohend: Indem wir nicht immer gleich und ungefiltert sagen, was wir denken, und indem wir uns nicht allein dem Willen unserer natürlichen Triebe hingeben, sondern unserem Handeln ein moralisches Korsett verordnen oder zumindest die eigene Kommunikation den gesellschaftlichen und kulturellen Standards anpassen, können wir uns alle in einem gemäßigten gesellschaftlichen Klima austauschen und unsere Ziele verfolgen, ohne einander über kurz oder lang die Köpfe einzuschlagen.
 Christian Bommarius: „Im Rausch des Aufruhrs — Deutschland 1923“
Christian Bommarius: „Im Rausch des Aufruhrs — Deutschland 1923“
Seit einigen Jahren lässt sich ein Sachbuch-Trend beobachten, den man „Jahrhundertbücher“ nennen könnte. Mit Sicherheit handelt es sich um keine neue Entwicklung; Bücher zu Jubiläen hat es immer gegeben: Festschriften, Jubeltexte und kritische Aufarbeitungen der Vergangenheit je nach Anlass und Absicht der Autoren.
Doch „gefühlt“ hat diese Jahrestags-Literatur in den vergangenen Jahren einen besonderen Aufschwung genommen, was vielleicht auch an der allgemeinen Faszination für die „Goldenen Zwanzigerjahre“, die ja so golden gar nicht waren, liegen mag. Nachdem das deutsche Kaiserreich der Leserschaft auf die Dauer vielleicht doch etwas zu fad geworden ist, steht nun endlich die Weimarer Republik im Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit! — Vor 100 Jahren …
Was waren das aber auch für tolle Jahre: Glitzernd, schillernd, halbseiden und verrucht, temporeich und lebenslustig — so sehen die 1920er Jahre in vielen Köpfen aus. Klischees sind langlebig und nur schwer aus den Köpfen zu kriegen, denn natürlich gab es „die“ Zwanzigerjahre ebenso wenig wie es „die“ 2020er Jahre gibt pauschalisierend gibt.
Um diesen Klischees entgegenzuwirken, bemühen sich Kulturwissenschaftler, Soziologen, Politikwissenschaftler und allen voran die Historiker, die Vergangenheit etwas differenzierter auszuleuchten und nicht auf die kontrastierende Wirkung von grellen Schlaglichtern zu vertrauen. Das interessierte Lesepublikum versteht und honoriert das; die Zeiten der vereinfachenden und holzschnittartigen Beschreibungen scheinen zum Glück vorüber, wenngleich es immer noch negative Beispiele aus jüngster Produktion gibt.
Mit dem vorliegenden Buch des Juristen, Journalisten und langjährigen Mitarbeiters der Berliner Zeitung Christian Bommarius haben wir ein positives Beispiel einer solchen Jubiläums-Literatur in der Hand.
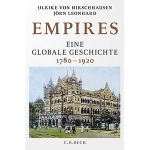 Ulrike von Hirschhausen und Jörn Leonhard: „Empires — Eine globale Geschichte 1780-1920“
Ulrike von Hirschhausen und Jörn Leonhard: „Empires — Eine globale Geschichte 1780-1920“
Eine Globalgeschichte der großen Reiche im „langen 19. Jahrhundert“ wäre vor einigen Jahren in dieser Form noch weitgehend unüblich gewesen. Zu sehr war der Blick der Historiker (wie auch der meisten anderen Geisteswissenschaftler) auf den europäischen Kontinent gerichtet; doch die Zeit des Eurozentrismus in den Wissenschaften scheint zum Glück endgültig hinter uns zu liegen; allseits versucht man nun beflissen, über den eurozentrischen Tellerrand hinauszublicken, und das ist gut so.
Zunächst erschien diese frühere Konzentration auf den europäischen Raum gleich aus mehreren Gründen plausibel und „natürlich“: Europäische Geschichte wurde in erster Linie als Nationalgeschichte be- und geschrieben, ein Erbe des 19. Jahrhunderts, in dem das nationalstaatliche Konzept zur Etablierung und Konsolidierung von Bemühungen nationaler Identitätsfindung priorisiert wurde; auf diese Weise wurden nationalistische Geschichtserzählungen bevorzugt — zu Lasten einer gesamteuropäischen Perspektive. — Eine Steigerung jener nationalgeschichtlichen Bestrebungen fanden im Personenkult des Historismus ihren Ausdruck: In dicken Folianten wurden hier der einzigartige Genius und die historische Bedeutung berühmter Persönlichkeiten für den „Gang der Geschichte“ herausgestellt; in den allermeisten Fällen waren es alte weiße Männer, die hier zwischen zwei Buchdeckeln zur Ehrung gelangten. Historismus und National-Geschichtsschreibung waren immer auch Zeugnisse einer „Geschichte von oben“, einer Herrschafts-Geschichte, in der das „gemeine Volk“ und die Besiegten bestenfalls am Rande Erwähnung fanden.
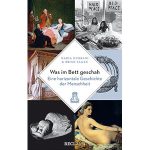 Nadia Durrani u. Brian Fagan: „Was im Bett geschah — Eine horizontale Geschichte der Menschheit“
Nadia Durrani u. Brian Fagan: „Was im Bett geschah — Eine horizontale Geschichte der Menschheit“
Die meisten von uns betrachten das Bett als einen sicheren Ort der Ruhe und Erholung. Hier passiert in der Regel nichts — zumindest nichts, was die Welt aus den Angeln heben könnte. Doch weit gefehlt! Verändert man die Perspektive und nimmt die gesamte Menschheitsgeschichte in den Blick, so wird man schnell auf einige historische Bettszenen stoßen, die die Welt veränderten.
Um es gleich vorwegzusagen: Dieses Buch bietet eine äußerst unterhaltsame und anregende Lektüre und ist daher zwar auch für die Bett-Lektüre geeignet; eine horizontale Lagerung des Lesenden ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Der Titel des Buches verspricht eine horizontale Reise durch die Weltgeschichte, und so ist es auch folgerichtig, dass sich die beiden Autoren zunächst mit dem „Bett“ als zentralen Ort jener Menschheitsgeschichte beschäftigen:
Was ist ein Bett? Wie und wo hat der Mensch angefangen, sich einen sicheren Platz für die Nacht zu schaffen? Wer hat wie, wo und wann geschlafen? Schlief man allein, zu zweit, zu vielen?
 Harald Welzer: „Zeitenende – Politik ohne Leitbild – Gesellschaft in Gefahr“
Harald Welzer: „Zeitenende – Politik ohne Leitbild – Gesellschaft in Gefahr“
Befindet sich unsere Demokratie in einer Krise? Hat die Politik längst in den Krisenmodus geschaltet? Wer ist schuld an dieser Krise? Ist es die Politik? Sind es die Politiker? Oder sind wir selbst die Schuldigen? Mit anderen Worten: Steckt der Westen in einer Krise, ist sie vorübergehend oder tief und lebensbedrohend, ist der Westen gar am Ende? Wie könnte ein Ausweg aussehen? Wo findet sich eine Lösung — nicht nur für die aktuellen politischen Probleme, von denen es ja genügend gibt — Krieg, Klima, Konjunktur (…)? — Auf all diese Fragen hat unsere Politik anscheinend keine Antworten parat und ist scheinbar in vielen Bereichen so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit kleinen Grabenkämpfen, Streitigkeiten um die Finanztöpfe, um Klimaziele und Schuldenbremsen, Kinderarmut und Fachkräftemangel, Inflation und Rezession, vor allem aber um die eigenen Befindlichkeiten. Dieser permanente Konfliktmodus bremst Entscheidungen und lässt vor allem eine große Leitlinie, ein politisches Ziel vermissen und erweckt den Eindruck, als stünde sich die Politik in erster Linie selbst im Wege. Das alles macht politische Prozesse intransparent und führt letztenden Ende dazu, dass sich viele Menschen längst von der Politik abgewendet haben und „denen da oben“ immer weniger zutrauen.
Vor vielen Jahren sprach man bereits von Politikverdrossenheit, es ist beileibe kein neues Phänomen. Man ahnte, dass es der demokratischen Landschaft auf Dauer nicht guttut, wenn sich die Politik ohne Profil und ohne Leitbilder nur noch den Tagesthemen zuwendet und zusieht, dass der Laden irgendwie weiterläuft.
